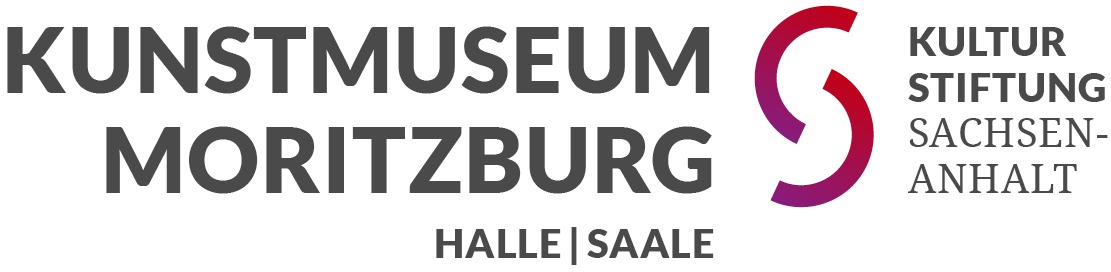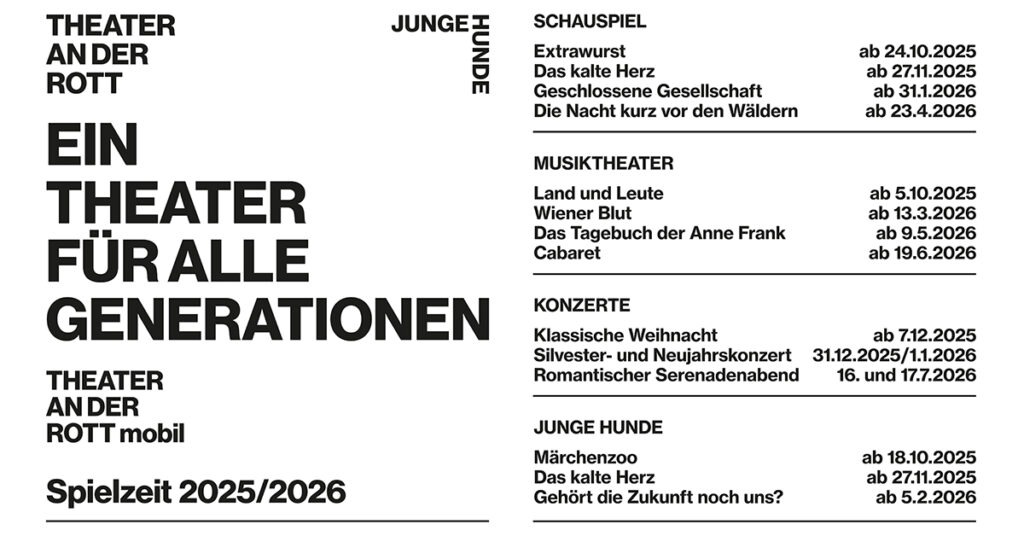©Stella Olivier
Mit seinem großartigen Weltenspiel „The Great Yes, The Great No“ begeisterte William Kentridge das Publikum bei der Uraufführung 2024 beim Festival Aix-en-Provence. Jetzt…
ist dieses hintergründige Gesamtkunstwerk aus Musik, Tanz, Theater, Media Art und Masken bei den Berliner Festspielen zu erleben. Grandios!
Die Bühne weitet sich durch Projektionen zum Kosmos. Unermüdlich kreist die Erdkugel. In Satellitenbahnen leuchten die markanten Sätze der Inszenierung auf. „Wo immer sie (die Flüchtlinge) hinziehen, es wird schlechter sein“.
1941 ist Europa am Ende. Das Schiff „Capitaine Paul Lemerle“ sticht von Marseille mit Kurs auf Martinique in See. An Bord befinden sich unter anderem die Schriftstellerin Anna Seghers, der Anthropologe Claude Lévi-Strauss und André Breton, Vordenker des Surrealismus.
Aus der wahren Begebenheit entwickelte der südafrikanische Künstler William Kentridge „The Great Yes, The Great No“, eine Geschichte über die weltumspannende Sehnsucht nach Freiheit und die auf jeder Ebene kontraproduktive Realität. Kentridge vermischt die Flucht vor dem Nationalsozialismus mit den Folgen der Kolonialisierung, integriert Bretons surrealistisches Konzept mit der Forderung einer unabhängigen, revolutionären Kunst, und verwandelt den Kapitän in Charon, den Fährmann der Toten, als kapitalistische Variante, bei dem nur das Geld zählt.
„Die Welt ist aus den Fugen“. Die Menschen flüchten auf einem ehemaligen Orangendampfer„Wir müssen uns dem Weltengang anpassen, verlassen das vom Schreien verkrampfte Europa“.
Ihre Sehnsüchte offenbart die Musik, der Kontrabass die depressive Melancholie, die metallische Perkussion die Anspannung der Nerven. Sieben afrikanische Sängerinnen loten mit indigenen Gesängen in acht Sprachen die Leidensfähigkeit der Menschen während der Kolonialzeit aus. Sie verstecken sich hinter Masken, verzwergen und fragen: „Sind wir denn keine Menschen?“ Das geht unter die Haut. Zwischendurch setzen französische Musette Walzer und karibische Salsa-Musik lebensfrohe Akzente. Tänzer sorgen für ironische Varieté-Unterhaltung.
Kentridge bindet weitere Persönlichkeiten aus der historischen Vergangenheit ein, ein linker intellektueller Kosmos mit dem Psychiater und politischen Denker Frantz Fanon, der Malerin Frida Kahlo, dem martikanischen Dichter Aimé Césaire, Mitbegründer der Negritude und den Schwestern Paulette und Jeanne Nardal, ebenfalls Pionierinnen dieser Bewegung. Die antikoloniale und feministische Dichterin Jeanne Aimée Marie Suzanne Césaire schreibt lauf sprechend ihre Gedanken auf. Stalin und Lenin sind kurz zu sehen, von Brecht Gedichte zu hören, André Breton verkündet sein Manifest des Surrealismus von der freien, revolutionären Kunst, während dokumentarische Filmaufnahmen mit Marschmusik die nationalsozialistische Realität einblenden und kleine rote Fähnchen der kommunistischen Künstler zum wuchtigen sowjetischen Fahnenschwingen im XXXL-Format anwachsen.
Wenn Joséphine Bonaparte mit Josephine Baker auftritt, treffen tänzerisch alte und neue Welt aufeinander, erweitert durch eine experimentelle Sequenz aus dem Triadischen Ballett. Doch die neue Welt hält nicht, was sie verspricht. In einem surrealen Video wird eine schwarze zappelnde Hand beim Dinner mit dem Besteck zerlegt, eine grausame Metapher für das Leid während der Kolonialherrschaft. Und immer wieder stimmen die sieben Sängerinnen den Klagegesang im Namen aller Frauen an, die letztendlich die Scherben der Kriege aufräumen müssen.
Das Weltenspiel endet, wie es begann. Die Träume bleiben Träume, zu verbrannt ist die Erde.
„The Great Yes, The Great No“ ist ein überaus komplexes, in jeder Beziehung außerordentliches Weltenspiel, emotional überaus tiefgründig und intellektuell anspruchsvoll. Trotz des Sprachenmix von Englisch, Französisch, isiSwati, isiZulu, isiXhosa, Setswana, Xitsonga, Sepedi ist das Stück dank der deutschen und englischen Übertitel gut verständlich.
Künstlerisches Team
William Kentridge – Konzept, Regie
Nhlanhla Mahlangu, Phala O. Phala, Luc de Wit – Co-Regie
Nhlanhla Mahlangu – Chor-Komponist
Greta Goiris – Kostümdesign
Sabine Theunissen – Bühnenbild
Tlale Makhene – Musikalische Leitung
Mwenya Kabwe – Dramaturgie
Urs Schönebaum, Elena Gui – Lichtdesign
Žana Marović, Janus Fouché, Joshua Trappler – Projektion (Schnitt & Mischung)
Duško Marović SASC – Kamera