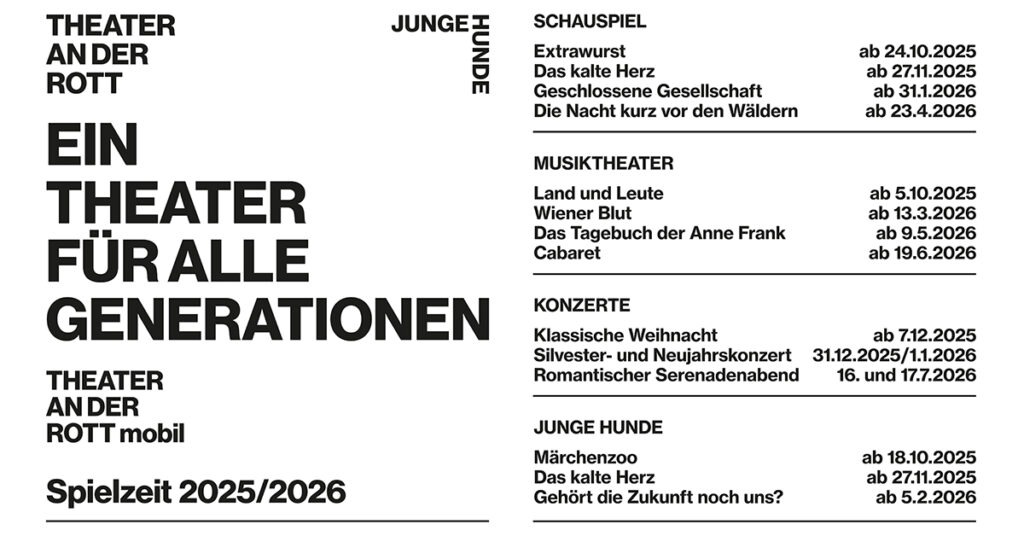©Komische Oper Berlin, Foto: Iko Freese
Jim kauft sich die Hure Jenny. Liebe ist das nicht, wie auch die Musik konterkariert, aber eine Seelenverwandtschaft von Einzelgängern, die in ihrer Gier nach Äußerlichkeiten und absolut individualistischer Freiheit keine echten menschlichen Beziehungen mehr eingehen können. Jim gibt schließlich die Parole aus, alles ist erlaubt, wenn man es bezahlen kann. Es folgt die Entgrenzung in Völlerei, Suff und Endlosfick in wuchtigen Szenenbildern, die unter die Haut gehen, mitunter bis zur Übelkeit reichen. Auf den falschen Favoriten im Boxkampf gewettet, verliert Jim sein ganzes Vermögen. Als er alle noch zum großen Besäufnis einlädt, ohne bezahlen zu können, landet er vor dem Hohen Gericht. Man kann zwar Frauen ficken, sich besaufen und bekämpfen, aber schuldig wird nur der, der nicht bezahlen kann. Jim wird auf richterliche Anordnung getötet und jeder, außer Jenny stößt das Messer in seinen Körper. Jim, das Großmaul, wird zum erbarmungswürdigen Opfer. „Schlimm ist der Hurrikan, schlimmer der Tornado, am schlimmsten der Mensch“.
Barrie Kosky macht daraus eine extrem dichte Collage zwischen existenziellem Theater und satirischer Theaterrevue, Moritat und surrealer Übertreibung. Nur die Stimme des Erzählers, Brechts episches Theater lässt grüßen, wirkt arg märchenhaft süß, was man natürlich als parodistische Übertreibung werten kann. Er selbst sieht „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ als Mittelstück zwischen Schönbergs „Moses und Aron“ und dem Musical „Anatevka“, aber auch ohne diese Stücke und Inszenierungen zu erkennen, wird Koskys Kernbotschaft deutlich. „Der Mensch ist kein Tier“ singt Jenny. Oh doch beweist die Inszenierung die angesichts der aktuellen Kriegssituation noch berührender wirkt.
Dem proletarischen Milieu folgt die Revue des Aufstiegs, ein Glitzern in schwarzen Kleidern und Anzügen. Gespiegelt multipliziert wird Masse fühlbar. Schließlich erscheint über menschliche Gerichtsbarkeit erhaben Gott höchstpersönlich als mechanisierter Affe auf einem Rollwagen durch die Spiegel gleich im Doppelpack. Alles ist Golem, wie Kosky ihn interpretiert, entglitten und über ihm verkündet das Schild statt „Emet“, Wahrheit, nur noch „Met“, der Tod. Mit verbundenen Augen ist Jim, als einziger in Jeans, orientierungslos wie ein Tanzbär der Masse ausgeliefert und liegt am Schluss abgestochen wie ein Tier auf der Bühne. „Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen da keiner zu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist’s du“. Das ist Brechts knallhartes Resümee, das Kosky expressiv in klaren Szenen herausarbeitet, wobei Kosky anvisierte Parallelität Jims zu Jesus letztendlich nicht die große Rolle spielt.
Die Inszenierung würde so nicht funktionieren, wäre nicht Kurt Weills großartige Komposition mit 20 Musiknummern, inspiriert von der damals bekannt werdenden filmischen Montagetechnik. Kurt Weill fusioniert die ungewöhnlich große Bandbreite der damaligen Musikrichtungen, kombiniert Arien à la Puccini mit Bachchorälen, Strawinskys Klangwelt mit Jazz, Swing und Tanzmusik, sehr klangschön und transparent unter dem dynamischen Dirigat von Roland Kluttig vom Orchester und vom Chor der Komischen Oper Berlin interpretiert. Kaum entwickelt sich eine wärmende Klangatmosphäre, durchbrechen sie forsche Tempi, apokalyptische Bläserpassagen oder wuchtige Schlagwerke. Der Tango überdreht in eine hetzende Milonga, dystope Klanglinien zerstören Arien.
Barrie Koskys reduzierte Inszenierung an der Komischen Oper findet ein Jahr nach der Premiere einen größeren Zuspruch als bei der Premiere und wird vom Publikum durch ein fast ausverkauftes Haus honoriert. Im Mittelpunkt steht rollenbedingt Eric Laporte als Jim. Es gelingt ihm der Spagat vom Schwerenöter zum Opfer und in den Arien gibt er der Inszenierung Augenblicke großer Oper, genauso wie Alma Sadé als Jenny.

©Komische Oper Berlin, Foto: Iko Freese
Sie ist das weibliche Kontrastprogramm zu Jim, aber weniger aufreißerisch als devot, nach seinen Wünschen fragend, aber nichts in Frage stellend, ausgebeutet von zwei Dutzend Männern, die sich in Miniintervallen auf sie legen. Das sind starke Szenen, die in der hemmungslos männlichen Sexgier MeToo assoziieren lassen. Nadine Weismann als Witwe Begbick verkörpert eine großartige Puffmutter. Sie weiß, wo sie abzocken kann, um Blecheimer zu füllen. Ihre resolute Stimme und Präsenz kennt weder Reue noch lässt sie Widerspruch zu.
Künstlerisches Team: Roland Kluttig (Musikalische Leitung), Barrie Kosky (Inszenierung)Katharina Fritsch (Spielleitung), Klaus Grünberg (Bühnenbild und Licht), Anne Kuhn (Bühnenbildmitarbeit), Klaus Bruns (Kostüme) Maximilian Hagemeyer (Dramaturgie), Jean-Christophe Charron (Chöre)