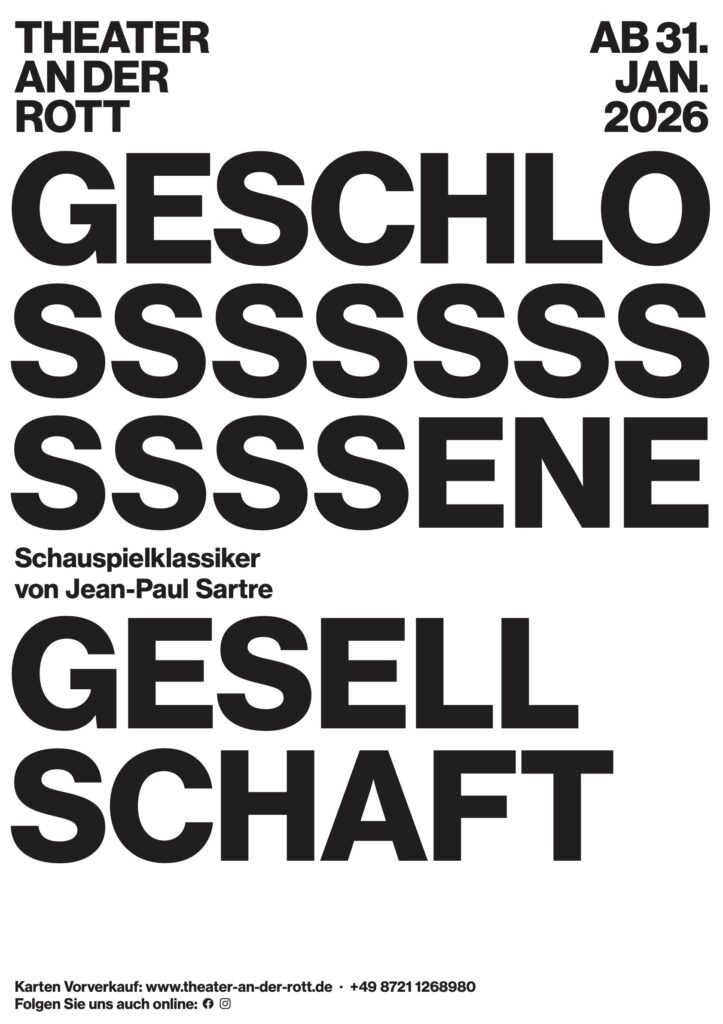©Bayerische Staatsoper München, Foto: Gioffroy Schied
Was wäre, wenn Don Giovanni einen Frauenkörper gehabt hätte? Von dieser Idee aus bringt David Hermann eine ganz neue Version des „Don Giovanni“ auf die Bühne der Münchner Staatsoper, in der…
Burleske und Requiem knallhart aufeinandertreffen und in surrealen Szenen existentielle Schwere und überraschender Situationswitz sich in einem ständigen Wechselspiel verdichten.
Inspiriert von einem „verschlüsselten Hinweis“ bei Librettist Da Ponte bezieht Hermann die mythologische Ebene des Hades mit Pluto und seiner geraubten Frau Proserpina mit ein. Schon bei der Ouvertüre sorgt das projizierte höllische Magmameer, dem Proserpina entsteigt für bombastische Bildwelten. Just in dem Augenblick, als Don Giovanni Anna in ihrer mondänen Villa verführen will, fährt sie in dessen Körper, was kostümtechnisch durch signalroten Bodydress und schauspielerisch durch leitmotivisch verwunderte Selbstbetrachtung und -befühlung den spielerisch witzigen Charakter der Inszenierung verstärkt, aber auch ständiges Rätseln über das Wozu produziert. Don Giovannis Libido bleibt auch in weiblicher Form ungebrochen. Als Schachzug gegen die MeToo-Bewegung denkbar, doch Hermann interessiert das Gegenteil, inwiefern eine weibliche Variante Don Giovannis mit Frauen anders umgehen würde. Wirklich fündig wird er nicht. Auf der Bühne fördert der Genderwechsel zunächst einmal burlesken Witz, die Einbeziehung der Mythologie neben atmosphärischen Effekten existentielle Fragestellungen, zumal Pluto immer wieder aufkreuzt, Pläne durchkreuzt, durch seine Präsenz die Hölle miteinbezieht und final sogar die Rolle des Komturs übernimmt.
Schon bei der Ballszene dreht die Inszenierung ins Existentielle, wenn sich die schrillen Maskierungen vor nachtschwarzem Hintergrund extrem überblendet surreal abheben, die Tanzrhythmik retardiert, Don Giovanni alle einlädt und „Es lebe die Freiheit!“ singt. Welche Freiheit, wo er doch gefangen ist in seiner Triebstruktur?
Der dunkle Grundton bleibt und so burlesk die Szenen auch angelegt sind, schwingt doch eine Beckettsche Schwere mit. Don Giovanni bereut sein Leben nicht, fährt wie gehabt in die Hölle. Doch sein Motto „Frauen sind wichtiger als Brot“ erhält in diesem Genderkontext eine neue Deutung. Mit Proserpinas neuer Verwandlung in Leporellos Körper weitet sich dieser „Don Giovanni“ in bester Burlesk-Manier zu einem feministischen Happyend mit Zerlina und Leporello als lesbischem Paar. Es ist ein witziges, gekonnt umgesetztes Gedankenspiel, aber Mozarteuphorie entsteht dabei nicht, auch wenn die sängerischen und schauspielerischen Leistungen beeindrucken und vom Publikum mit viel Zwischenapplaus honoriert werden.
Vera-Lotte Boecker wandelt die verführerische Donna Anna in einen Rache-Furie. Avery Amereau präsentiert Zerlina als junge, leicht manipulierbare Frau, die sich den sinnlichen Genüssen nur allzu gerne hingibt. Am meisten lässt Samantha Hankey aufhorchen. Sie bringt Elviras Spannungen zwischen erlittenen Enttäuschungen und nicht loslassender Liebe in fulminanten Koloraturen immer leidenschaftlicher zum Ausdruck.
Bei den Männern sticht Giovanni Salas als Don Ottavio heraus. Durch sein geschmeidiges Timbre wird jeder Auftritt zum Hörerlebnis. Kyle Ketelsen als Leporello und Michael Modfidian als Masetto überzeugen durch kraftvolles Timbre und burleske Spielfreude. Konstantin Krimmel kann seine an sich fulminante Stimme partiturbedingt arios nur wenig zeigen, ist aber schauspielerisch und rezitativ sehr präsent. Christof Fischesser als Komtur hätte noch durchdringender klingen können.
Unter der musikalischen Leitung von Vladimir Jurowski und Hermanns Regie gehen Musik und Optik Hand in Hand. Mozarts musikalische Präzision wird sichtbar, das Bühnengeschehen aus dem Orchestergraben klanglich und rhythmisch hörbar. Die Stimmen bei der besuchten dritten Vorstellung kommen bestens zur Wirkung. Ausgesprochen klangschön, dynamisch ausbalanciert, in wechselnden Tempi, mit wunderbar knappen Decrescendi spielt das Bayerische Staatsorchester in bester Mozartmanier, aber die Inszenierung zieht zu viel Aufmerksamkeit ab. Das Denken und Ergründen steht dem Genießen im Wege.