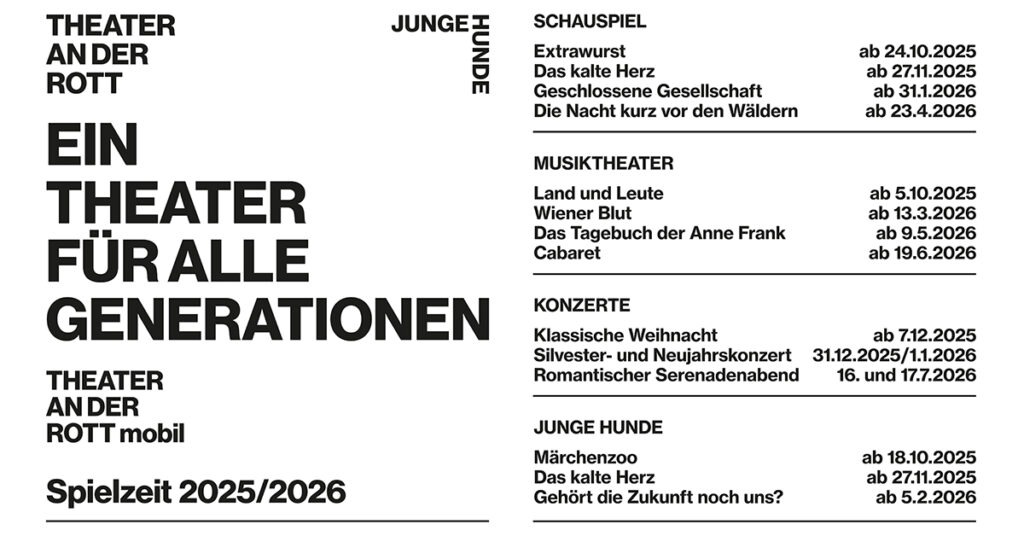©Berliner Ensemble, Foto: Jörg Brüggemann
Ein neoleuchtendes dreiseitiges Prisma gut zwei Meter über dem Boden vor dem schwarzen Theatervorhang schwebend zieht magisch in seinen Bann. Eine eindringliche Stimme wird hörbar, die einen Brief vorliest gerichtet…
an einen, der ihn immer wieder lesen soll, damit ihm seine Eitelkeit und Oberflächlichkeit bewusst wird. Es ist Jens Harzers Stimme, dessen Kopf abrupt in der Rolle Oskar Wildes erscheint. Wie von einer Kanzel herab, umspielt von dezenter Orgelmusik schildert er, wie der renommierte Schriftsteller unter der homosexuellen Beziehung zu seinem Liebhaber Lord Alfred Douglas leidet.
50.000 Wörter lang gilt „De Profundis“ als einer der bedeutendsten Liebesbriefe der Literatur. Der Titel bezieht sich auf Psalm 130. „De profundis clamavi ad te Domine“ – „Aus der Tiefe Herr, rief ich zu dir“. Während seiner 2-jährigen Haft schrieb Wilde diesen Brief in höchster Verzweiflung. Der Vater seines Liebhabers hatte ihn, der sich offen zur Homosexualität bekannte, wegen Unzucht angeklagt. Intendant Oliver Reese reduzierte den Text auf knappe zwei Stunden, eine Steilvorlage für Jens Harzer, der in dieser Spielzeit vom Thalia Theater Hamburg an das Berliner Ensemble gewechselt ist.
Elegant mit weißem Hemd, Schlips und Jackett monologisiert er, seit 2019 Ifflandring-Träger, über Wildes toxisches Verhältnis zu seinem Ex-Lover, der ihn finanziell und menschlich ruinierte, im Grunde nur kam, wenn er Geld brauchte, das er mit anderen verprasste, für den Wilde nur interessant war, „wenn er auf einem Sockel“ stand.
Wie ein animiertes Porträt kristallisiert Harzer zunächst nur mit seiner faszinierenden Stimme die Gegensätze dieses ungleichen Paares heraus, Wilde als der intellektuelle Künstler, geschaffen für das Schöne, Douglas als exzessiver, oberflächlicher und skrupelloser Lebemann, was Wilde zunehmend langweilte und einengte. Trotzdem hatte er Douglas gern.
Mit der Inhaftierung wandelt sich das Prisma über einen schmalen Quader zur Gefängniszelle. Ganz ohne Pathos mit subtilem Tiefgang offenbart Harzer das unendliche Leid Wildes. Noch hängt ein kleines Foto von Douglas an der Wand. Irgendwann zerreißt er es, klebt es wieder hin. Mit schwarzer Kreide malt er einen Pfosten an die Wand, der Selbstmordabsichten assoziieren lässt. Ein schwarzes Seil, das er entdeckt, entpuppt sich als Mikrofon. Es ist die Sprache, die ihn durchhalten lässt, und sein Denken, das die Beziehung in immer neuen Facetten aufrollt. Wilde bereut nicht, ins Gefängnis gegangen zu sein. Harzer zeigt, wie Wilde versucht seine Würde optisch und argumentativ zu behalten, und doch wie ein wildes Tier verkommt, wenn er einen Apfel zerquetscht und in den Mund stopft, sich blutig beißt, sich mit schwarzer Kreide verschmiert. Je nach psychischer Belastung, wandeln sich die Lichtstimmungen in der Zelle. Die weißen Seitenflächen rutschen hinunter, verengen die Zelle scheinbar noch mehr und verdeutlichen die immer größer werdende Bürde des Leids eines Menschen, der immer noch liebt, was ihn zerstört, um Zuwendung bittet, die er niemals erhalten wird. Zwischen Hocker und Ecke eingezwängt, verzwergt, verzweifelt, die Orgelmusik immer lauter, von schweren Hämmern malträtiert scheint Harzers Wilde nicht mehr weit entfernt vom Irrsinn. Doch er hält durch, wenn auch fragil und immer stärker zuckend, zuerst mit den Beinen, dann mit den Armen und schließlich mit dem Kopf. Er hat ein Ziel, nach der Haft ohne sich schämen zu müssen, wieder in Freiheit leben zu können und sich der Kunst und dem Schönen zuzuwenden. Doch er weiß nur zu gut, dass die Gesellschaft keinen Platz mehr für ihn haben wird, eher die Natur, wo er sich in einer Felsenritze verstecken kann.
Wenn sich der Abend auch gegen Ende durch Wiederholungsstrukturen etwas längt, ist er schauspielerisch gesehen ein einzigartiges, mitreißendes Theatererlebnis.
Künstlerisches Team: Oliver Reese (Textfassung, Regie), Hansjörg Hartung (Bühne) , Elina Schnizler (Kostüme), Jörg Gollasch (Musik), Steffen Heinke (Licht), Johannes Nölting (Dramaturgie)
Mit: Jens Harzer