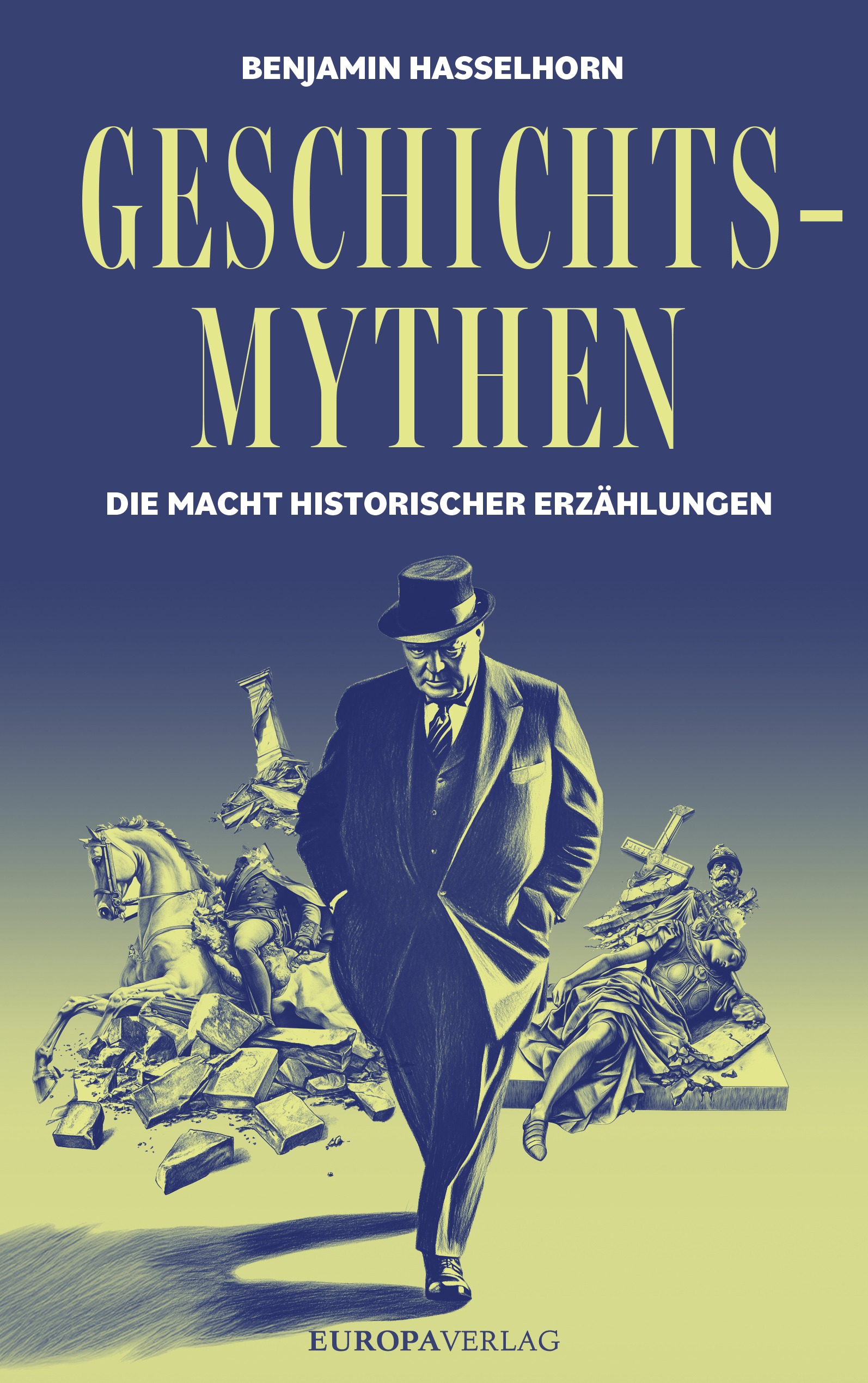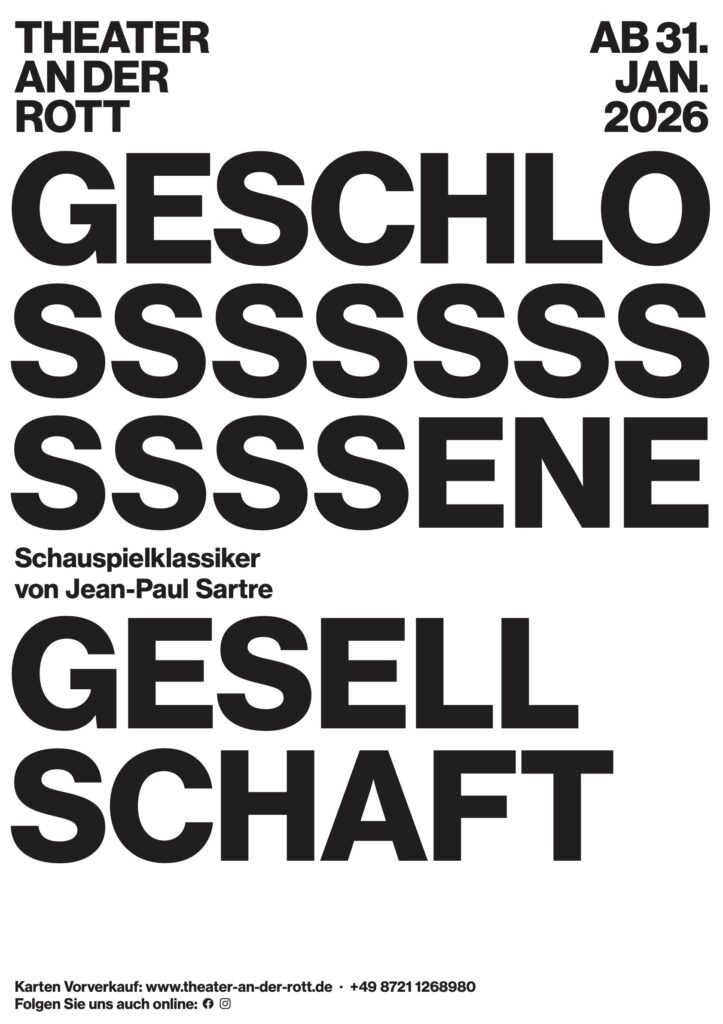©Europa Verlag
Was sind eigentlich Mythen im Gegensatz zur Geschichte? Genau dieser Frage…
geht Benjamin Hasselhorn in seinem neuen Buch „Geschichtsmythen – Die Macht historischer Erzählungen“ nach. Geschichte und Mythen beziehen sich auf die Vergangenheit. Für eine klare Abtrennung fehlt es bislang an einer eindeutigen Begrifflichkeit und systematischen Darstellung. Beides liefert Hasselhorn mit quellenanalytischer Genauigkeit gleich zu Beginn. Beides sind Narrative über die Vergangenheit. Geschichte ist nachweisbar, Mythen nicht, wirken aber in der Gegenwart sinnstiftend.
Darüber hinaus zeigt Hasselhorn exemplarisch, wie sich Mythen in einer Gesellschaft etablieren, welchen Wandlungen sie ausgesetzt sind, wie sie bekämpft werden und wieder verschwinden können.
Am Beispiel von Wilhelm dem Großen und Bismarck erklärt er im zweiten Kapitel den Unterschied zwischen „gemachten“ und „spontanen“ Mythen. Durch Denkmäler, Feiertage, Jubiläumsgeburtstage, Festschriften erhöhte Wilhelm II. aus machttaktischen Gründen seinen Vorgänger Wilhelm I., während sich der Bismarck-Mythos spontan aus dem Lebensalltag als Symbol deutscher Einheit entwickelte. Beide Mythen stimmen aus heutiger Sicht nicht mit der damaligen Realität überein. Aber über den Bismarck-Mythos konnte man das Bedürfnis der Massen nach nationaler Identität besser befriedigen als mit Wilhelm dem Großen. Die Nation zählte mehr als die Monarchie, zuerst im Rahmen der Nationalsozialisten, dann bei der Gründung der BRD. Entscheidend ist in beiden Fällen ein relevantes Geschichtsereignis, das damit verbundene Sinndeutungsbedürfnis.
Wie wandelbar die Geschichtsmythen sind, stellt Hasselhorn im dritten Kapitel am Beispiel des Martin-Luther- und Jeanne-d’Arc-Mythos dar. Wenn keine Transformationen in neuen Gesellschaften oder durch neue Träger mehr möglich sind, verblassen Mythen. Der Wandel von Luther als Symbol der Freiheit ins Deutschnationale gelang, spätere Anpassungen im Umfeld der DDR und der Kirche waren weniger erfolgreich, weil sich der narrative Kern verschob, ihm direkt widersprach oder den positiven Sinnbezug untergrub. Ganz anders transformierte der Jeanne-d’Arc-Mythos durch Weglassen des Frankreichbezugs zur globalen Verkörperung von freiheitlichen Werten und opferbereitem Widerstand. Entscheidend ist dabei, dass der Kern des Mythos erhalten bleibt. Putin gelang es, vertraute Mythen aus der zaristischen und sowjetkommunistischen Ära trotz ihrer eklatanten Widersprüchlichkeit über seine Person zu fusionieren und selbst zum Mythos von Wehrhaftigkeit und Vater des Volkes zu werden.
Im vierten Kapitel „Mythenkämpfen“ unterscheidet Hasselhorn den „umkämpften Mythos“ für ein- und denselben historischen Gegenstand vom „bekämpften Mythos“, der eine historische Situation völlig ablehnt. Entscheidend ist, wie stark der Mythos die gesellschaftlichen Bedürfnisse befriedigt, wobei eine zersplitternde Deutungshoheit den Mythos durchaus verstärken kann und die gesellschaftliche Dynamik zum Ausdruck bringt, wie das Beispiel Bismarck beweist, der von Sozialisten, Klerus, Groß- und Kleindeutschen gleichermaßen vereinnahmt wurde. Dagegen verblasst ein Mythos, wenn er nur noch von einer Gruppe anerkannt wird, bezüglich seiner Sinnfunktion Schwächen zeigt oder sich ein Gegenmythos entwickelt, der sich aber nur bei den aufgezeigten Schwächen erfolgreich etablieren lässt.
Final beweist Hasselhorn, dass anhand der bereits besprochenen Mythen und vor allem am Churchill-Mythos, wissenschaftliche Mythenkritik wirkungslos bleibt, so lange ein Mythos von der Gesellschaft getragen wird.
Hasselhorns Thematik ist durchaus sehr interessiert, aber durch die wissenschaftliche Arbeitsweise des ständigen Vergleichens und Zitieren und ständige inhaltliche Überschneidungen anstrengend und ermüdend zu lesen. Mit 35 Seiten Literaturangabe und 55 Seiten Anmerkungen ist das Buch mehr Doktorarbeit als allgemeines Sachbuch, was den Leserkreis einschränkt.
Ein kurzes Statement anstelle von 25 Seiten Einleitung, in denen die Beziehung von Geschichte und Mythos hinterfragt wird, hätte die Vorfreude auf das Thema erhöht. Mehr Beispiele anstelle der ständigen Wiederholungen wären eine interessante Bereicherung gewesen.
Benjamin Hasselhorn ist Akademischer Oberrat a. Z. am Lehrstuhl für neueste Geschichte der Universität Würzburg. Er forscht über die politischen und gesellschaftlichen Dimensionen historischer Erzählungen mit Schwerpunkt Martin Luther und die Hohenzollernmonarchie im 19. und 20. Jahrhundert. Er promovierte 2011 in evangelischer Religionslehre, 2014 in Geschichte. 2017 kuratierte er die Nationale Sonderausstellung zum Reformationsjubiläum in Wittenberg. 2024 habilitierte er sich mit „Churchill und andere Mythen“. 210 erhielt er den Jürgen-Moll-Preis für verständliche Wissenschaft.
Benjamin Hasselhorn: Geschichtsmythen – Die Macht historischer Erzählungen, Europa-Verlag, 2025 München, 373 S.