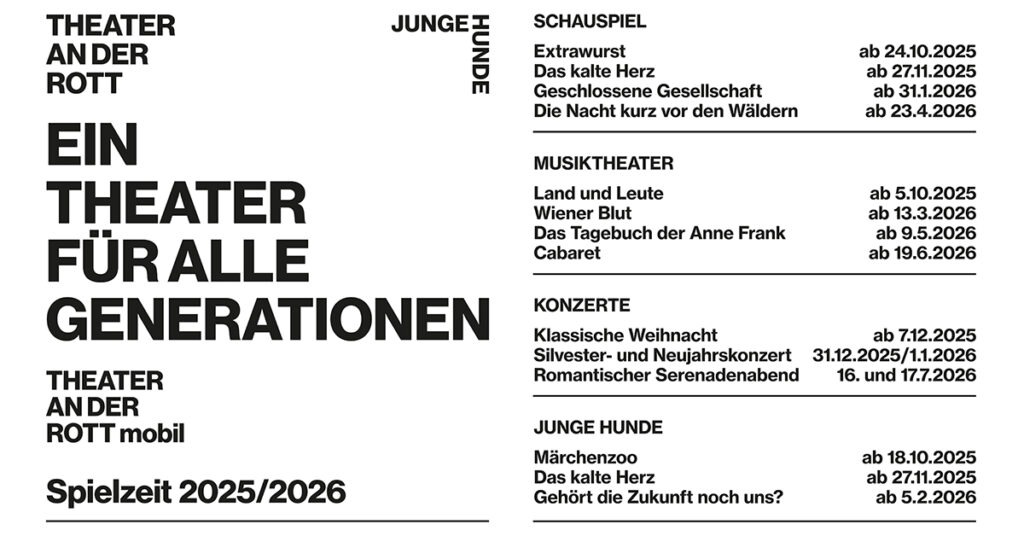©The Romeo, Foto: Orpheas Emirzas
Der Zuschauerraum bleibt vorerst hell. Das Publikum muss sich gedulden. Die TänzerInnen in unterschiedlichster Optik, groß und klein, athletisch und zierlich, schlank und oversized sitzen lässig auf der Bühne, machen mitunter eine kurze tänzerische Bewegung zum Groove eines Saxophons. Sie stellen sich in ihrer Alltagskleidung vor. Jeder hat irgendein Problem. Ein Moderator appelliert den Infozettel über „The Romeo“ zu lesen, während sich die Tänzer umziehen, um nach einer Viertelstunde schreitend, sich wiegend die Bühne zu erobern. In wellenförmigen Bewegungen von Brustraum und Becken, stark geprägt vom Voguing, dem Tanzstil der Trans- und Schwulengemeinden in Harlem der 1970er Jahre, der Tanzsprache Martha Grahams und Isidora Duncans, tanzt das Ensemble eine Stunde lang immer denselben rhythmischen Puls zu einem klassischen Klaviersound von Vladimir Cosma und Philip Corner, der zuweilen durch Arien, Blues und Pop atmosphärisch variiert wird, um Epochen- und Generationswechsel zu markieren. Der tänzerische Duktus bleibt gleich, es soll ja ein Tanz für jedermann sein. Auf die musikalischen Finessen wird kaum reagiert. Nur in manchem Solo leuchtet etwas individuelle Dynamik auf. Den tänzerischen Gleichklang versucht man mit modischen Akzenten aufzupeppen, wobei der ständige Persönlichkeits- und Rollenwechsel thematisiert wird, aber „The Romeo“ immer mehr zur bizarr witzigen Modenschau mit Cat-Walk-Stolzieren und entsprechendem Posing degradiert. Kurz leuchtet das Altern auf, wenn die TänzerInnen immer gebückter oder in Schieflagen weiterschwingen. Weichgespült vom psychodelischen Dauerschwingen verliert selbst der Tod seinen Schrecken. Aller flippigen Kleider entledigt schwingt man in eine andere Welt. Konzeptionell durchaus interessant vermag die Performance nicht wirklich zu begeistern. Von einem Tanzfestival erwartet man schon auch tänzerische Qualität.