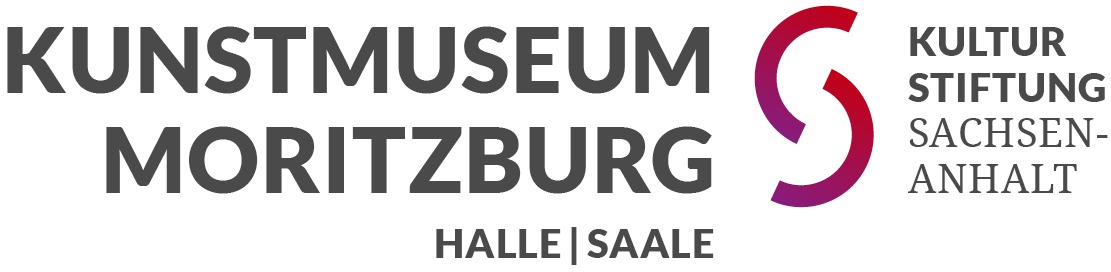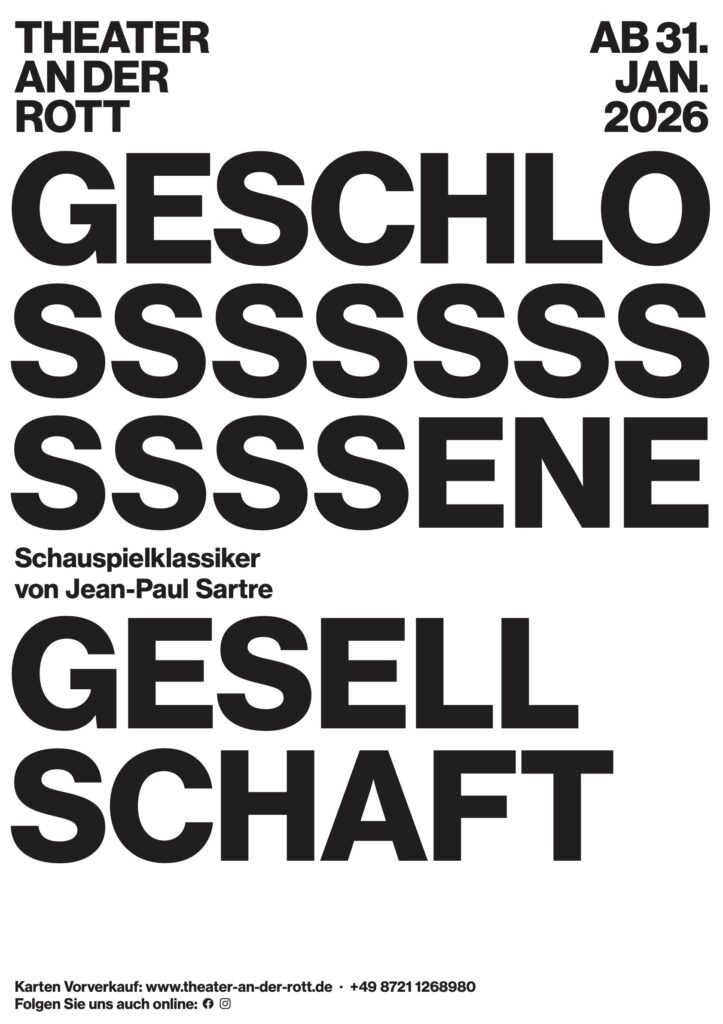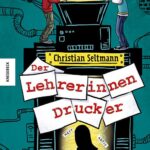©Salzburger Osterfestspiele, Foto: Inés Bach
Mit katakombisch, dystopisch vibrierendem Sound beginnt die Salzburger Version von Mussorgskis unvollendeter Oper „Chowanschtschina“. Dann schleicht sich subtil das Orchester ein, der in rot-orange gehaltene Theatervorhang erhellt sich fragmentarisch, entschwindet und lenkt den Blick auf das Schlachtfeld über eine schräge Anhöhe zu einem musikalisch untermalten Sonnenaufgang. Sofort wird klar…
hier geht es um Rebellion und Neubeginn, um die Geburt einer Nation. Warum ist Russland so, wie es ist? Mussorgskis „Chowanschtschina“ (Verschwörung) spürt den Wurzeln der russischen Seele nach, geprägt von der Angst weniger Mächtiger, die das Volk versklaven, so dass es nur noch Hoffnung in religiöser Gläubigkeit findet. Das künstlerische Team mit Esa-Pekka Salonen (musikalische Leitung) und Simon McBurney (Inszenierung) entschied sich für die fulminante Version von Dimitri Schostakowitsch und fokussiert auf den spannenden Kontrast von wuchtigen Volks- und Chorszenen und überaus lyrischen Passagen, verstärkt durch Igor Strawinskys finale Chorpassage und zusätzliche Arrangements von Gerard McBurney.
Das malträtierte Volk steht im Mittelpunkt. Manipuliert von Informationen, deren Wahrheit nicht überprüft werden kann, zieht es immer den kürzeren und folgt dem religiösen Führer Dosifey in den kollektiven Flammentod. Gleichzeitig avanciert die arme Marfa als Unheil verkündende Wahrsagerin zur mythischen Figur. Wie aus einem Märchenbuch kristallisiert sie sich aus der Bühnenschräge heraus, die zu Beginn historische Rebellion mit Naturerlebnis und realen Neubeginn verbindet, ein großartiger Einstieg, der sich zwar etwas hinzieht, aber dann zu einem sehr spannenden Macht-Epos verdichtet. Ziel ist weder Mussorgskis historischer Blick vom 19. Jahrhundert auf die 10-jährige Revolution vor Amtsbeginn Peter des Großen im 17. Jahrhundert noch eine Aktualisierung auf das heutige Putin-Russland wie an der Staatsoper Berlin (2024) sondern die Tatsache, dass dieses Mächteungleichgewicht überall und jederzeit stattfinden kann und wo Mussorgski nach den Wurzeln der russischen Gläubigkeit sucht.
Durch und durch russisch ist die Musik. Die düster melancholischen, mitunter tänzerisch folkloristischen Chorpassagen, die hochemotionalen Tiefen der Solisten machen ganz spezifisch die Pein der russischen Seele erlebbar. Bühne und Musik spiegeln die landschaftliche Weite und metaphorische Symbolik sozialer Unterdrückung, woraus sich die russische Melancholie entwickelte. Eine schwebende Büroetage mit Anzugträgern, Symbol der Macht, scheint das Volk schier zu erdrücken. Lichtspots, Schattenspiele, Videoeinspielungen schaffen magische Momente und mitunter den Sprung in die Gegenwart, wenn der rebellische Strelitzenführer Fürst Iwan Chowanskij kokst, sich in einer pompösen Badewanne von jungen Mädchen in Glitzerkleidchen verwöhnen lässt, von Bass Vitalij Kowaljow großartig interpretiert. Den Inbegriff russisch-orthodoxer Gläubigkeit vermittelt Ain Angers warm durchglühter charismatischer Bass als Dosifey. Nadezhda Karyazinas Debüt in Salzburg in ihrer Starrolle der Marfa lässt durch ihr großes Tonvolumen aufhorchen. Die Inszenierung, auf allen Ebenen bestens besetzt, unterstreicht Esa-Pekka Salonen mit orchestraler Wucht, so dass die ganz zarten Pianissimi umso mehr aufleuchten. Ein in jeder Beziehung spannender Opernabend.