Berlin – Staatsoper – Uraufführung von Sciarrinos
„Ti vedo, ti sento, mi perdo“
Die Stille ist ihm wichtig, die Stille zwischen langgezogenen Tönen, kleinen Melodienlinien. Töne tauchen auf dem Nichts aus und verschwinden, bauen geheimnisvoll abgründige Klangräume auf, in denen Klangmuster aus anderen Musikepochen auftauchen und fusionieren. Selten ist die Stille tatsächlich still. Beim Lauschen werden plötzlich Hintergrundgeräusche hörbar.
Salvatore Sciarrinos Musikstil ist unverkennbar. 13 Opern hat er inzwischen kontinuierlich komponiert, ungewöhnlich viele für einen modernen Komponisten. Allesamt sind sie subtile Kammerspiele, im Laufe der Zeit mit immer mehr Sängern, größerem Orchester, eigenen Texten und Stoffen voller literarischer Anspielungen, denn „nichts ist ohne Quelle“.
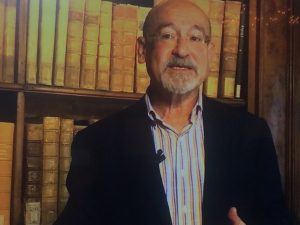
© Michaela Schabel nach Ausstellungsvideo in Berliner Staatsoper
„Ti vedio, ti sento, mi perdo“, eine Auftragswerk der Berliner Staatsoper und Mailänder Skala unter der Regie von Jürgen Flimm wurde bereits 2017 in Mailand uraufgeführt. Jetzt ist als deutsche Erstaufführung in der Berliner Staatsoper zu hören.
Die Spielhandlung scheint simpel. Eine Künstlergruppe probt eine Cantate um die Figur Orpheus. Gleichzeitig wartet die Primadonna auf eine Arie Stradellas, die er ihr versprochen hat. Doch statt der Arie erreicht die Gruppe die Nachricht von Stradellas Ermordung.
Daraus entwickelt Sciarrino vielschichtige, durchaus humorvolle Anspielungen auf drei Ebenen. Neben moderner Musikoper bezieht er musikhistorisch Leben und Schaffen Stradellas mit ein, gleichzeitig den Orpheus-Mythos, der sich in Stradellas dionysischen Liebeseskapaden barocker Art spiegelt.

©Clärchen und Matthias Baus
Jürgen Flimm kreiert dazu eine zauberhaft ästhetische Ebene, in dem er den subtilen Charakter der Musik traumhaft surreal mit einigen kräftigen Farbtupfern präsentiert. 400 Jahre Operngeschichte werden in Kostümen, Bühnenbauten, Lichteffekten sichtbar, aber eben nicht als bunt grelles Allerlei, sondern in fein dosierten Kostümzitaten mit Schwerpunkt reduzierter Renaissance-Halskrausen, mehr oder weniger ausladenden Barock-Reifröcken, ironisch handgekurbelter barocker Bühnentechnik, feinsten Farb- und Lichtstimmungen. Ein langes hin- und hergetragenes Brett wird zum Running-Gag abstrusen Bühnengeschehens. Glas- statt Steinsäulen entrücken in Traumwelten, Schattenspiele und Sandsäcke vom Licht zu aufgehängten Leichen modellieren in Alpträumen fiktive Realitäten.
Überaus präzise, charmant, mit originären Witz erweckt Flimm die Oper zum Leben. Jede Geste, jede tänzerische Bewegung, passt, durchpulst vom Herzschlag der Musik und mittendrin erstarrt auch das Bühnengeschehen in absoluter Stille. Hier lenkt Optik nicht ab, sondern akzentuiert die Musik und entdeckt in der Musik die Räume für humoristische Distanz und Sciarrinos Quintessenzen. Wenn gestrenge Renaissance-Männer kleine Ballettmädchen von heute wie Pakete auf die Bühne tragen, dazwischen die kleinen Tänzer mit Halskrausen, gelingt eine witzige Metapher musikalischer Fusion. Diese augenzwinkernde Ironie, zwischen bekannten Mustern und ganz neuen Ideen macht diese Inszenierung so charmant.
Das gelingt natürlich nur, weil der Herzschlag dieser Oper auf alle Sänger und Statisten überspringt. Jeder scheint mit Spielfreude und Leidenschaft dabei zu sein. Großartig passen die Stimmlagen zusammen. Laura Aikin strahlt nicht nur als Primadonna, sondern auch durch schauspielerische Brillanz. Sie singt wie eine Sirene, koloriert barock, schattiert Töne modern abgründig eine famose Sciarrino-Interpretin. Famos singen und ironisieren Bassbariton Otto Katzameier und Tenor Charles Workman als Musiker und Literat die Ebene der Theatermacher mit Blick für weibliche Reize, klangvoll Klatsch und Mutmaßungen über Stradellas Liebesabenteuer „im Labyrinth der Damen“ verbreitend. Burlesk derb im Stil der Commedia dell´ arte spiegeln Thomas Lichtenecker als Solfetto und Christian Oldenburg als Finocchio auf Dienerebene die Theaterprobe. Der Chor und hinterfragt ganz in antiker Tradition, welche Musik man wählen solle. Mit „Dionysus gegen Dionysus“ wird Sciarrinos Kompositionsansatz trefflich formuliert.
Die Musiker, ausgewählte Streicher und Bläser seitlich auf Bühnenhöhe, wissen unter dem Dirigat von Maxim Pascale um die Kunst der Klangfarben und der Pause. Umso wirkungsvoller entfaltet sich jeder Ton sonor an- und abschwellend, die Abgründigkeit der Celli und Violine, das Hauchen der Querflöte, die Akzente der Bläser. Umso effektvoller wirken die musikalischen Passagen Stradellas, dem Erfinder des Concerto Grosso, die wenige Arien zwischen den minimalistischen Klanglinien. Alles zusammen ergibt einen bezaubernden Opernabend, zwar ohne den Sciarrino-Gänsehauteffekt, dafür mit viel subtilen Humor. Diese Mal herrscht die Maxime die Seele nicht von den Sinnen zu trennen.
Michaela Schabel
Kommentare an michaela.schabel@freenet.de












