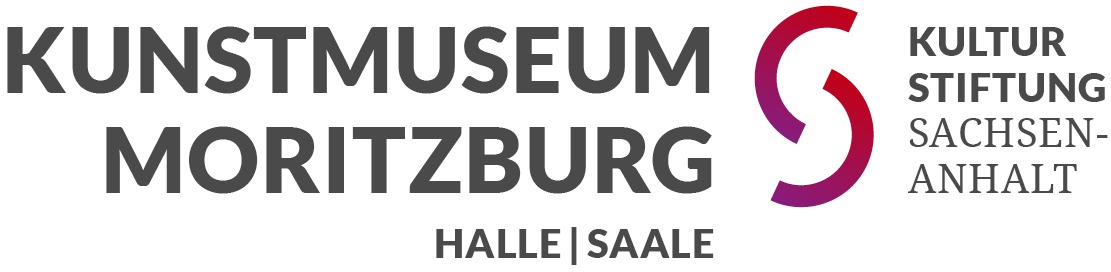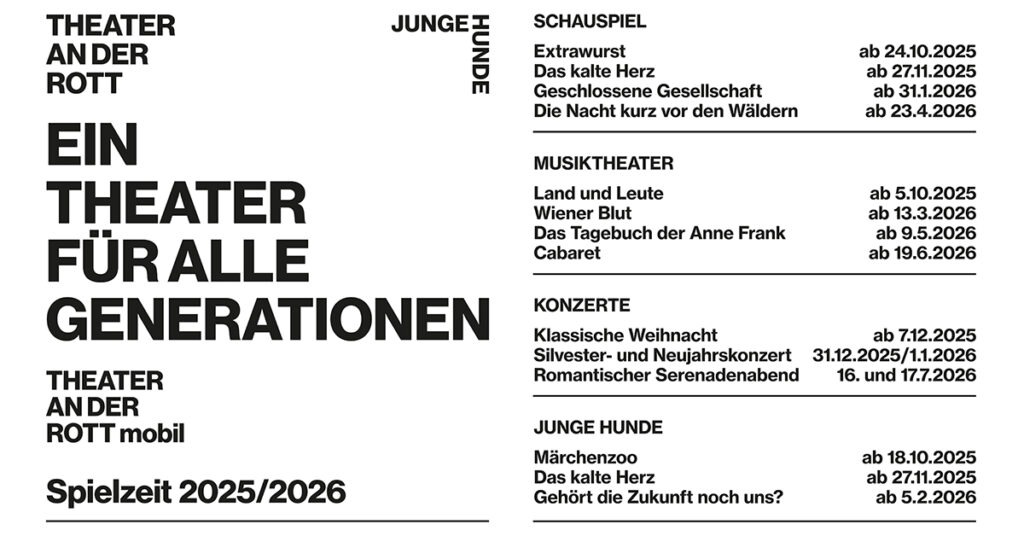©Fabian Schellhorn
Mit Luciano Berios „Cis“-Ton aus „Requies“ (1983/84) beginnt das Konzert, mit dem „Es“ aus Jean Sibelius’ „Sinfonie Nr. 5“ (1919) endet es. Dazwischen präsentiert…
Esa-Pekka Salonen sein neues „Konzert für Horn und Orchester“, eine Auftragsarbeit für das Lucerne Festival 2025. In allen drei Werken stehen Facetten der Töne im Vordergrund, das Entstehen von Melodien, das Interagieren, Dialogisieren, Kommentieren der Tonlinien, gleichzeitig ihre Auflösung und ihr Verschwinden. Es sind intellektuelle Kompositionen über die Entstehung von Musik, wobei die Tonartencharakteristik und die damit verbundenen emotionalen Schattierungen, wie sie im 19. Jahrhundert gepflegt wurden, keine Rolle mehr spielen.
Neben diesem Aspekt verbindet die drei Werke die bestimmende Kraft der Hörner, wobei sich durch Salonens Programmwahl vom Kammerspiel über das „Konzert für Horn“ bis zur 5. Sinfonie“ eine dramaturgische Spannungskurve aufbaut und das Orchestre de Paris unter seinem stringenten, immer leidenschaftlicheren Dirigat Tempi, Dynamik und Artikulation fulminant aufleuchten lässt.
In Berios (1925-2003) „Requies“, komponiert für seine verstorbene Frau, Stimm-Legende Cathy Berberian, entwickeln sich aus dem leisen Cis weitere Töne. Klänge flirren, schweben als Fermaten, formieren sich zu Tongirlanden, die sich in einem wuchtigen Fortissimo entladen. Das Publikum erlebt eine kammerorchestrale Reise, die aus einer einfachen Tonlinie die Kombinationsvielfalt der Orchesterinstrumente aufleuchten lässt. Das Pariser Kammerorchester spielt die Tonlinien überaus kreativ artikuliert. Es verlebendigt die Entstehungsprozesse, intensiviert sie durch expressive Echoeffekte, unterbricht sie spannend durch tonale Rückblenden und Abschweifungen. Man taucht staunend ein in die faszinierende Welt der Töne. Durch die konzeptionelle Freiheit der Töne ergeben sich ganz neue tonale Facetten des Dialogisierens und Kommentierens. Nimmt man den autobiografischen Anlass Berios hinzu ergeben sich trotz aller Abstraktion narrative Assoziationen über menschliche Beziehungen. Am Schluss überrascht eine zarte Flötenmelodie über dem finalen Cis, sozusagen als Abschiedsgruß an seine Frau, aber auch als Hommage an die Schönheit einer schlichten Melodie.
Salonens neueste Komposition „Konzert für Horn“ ist die Überraschung des Abends. Selbst Hornist schrieb er ein extrem facettenreiches, anstrengend virtuoses Werk im Sinne einer modernen Repertoireerweiterung für Stefan Dohr, weltweit nachgefragter Hornist der Berliner Philharmoniker. Die Herausforderung an diesem Abend direkt vor dem Komponisten das Werk zu interpretieren meistert Dohr absolut souverän, mit verblüffenden tonalen Effekten, die bei jedem Solo aufs Neue überraschen. Aus einer kleinen Hornmelodie entwickelt sich ein dreisätziges Werk, das ganz ruhig beginnt, aber gerade dadurch die faszinierenden Tonfacetten der unterschiedlichen Instrumente aufleuchten lässt. Im zweiten, noch ruhigeren Teil wird eine hauzarte lyrische Passage der Streicher, eine der spannendsten Sequenzen, niedergepaukt. Das Lyrische weitet sich dennoch aus, wobei die Tonenergie des Horns sehr empathisch zum Ausdruck kommt. Aus dem Pizzicato der Streicher offenbart sich final durch die Rhythmik der Bongos, extreme Tonsprünge und dynamische Kontraste eine fulminante Neuvermessung traditioneller Tonalitäten. Das ist über die anspruchsvolle moderne Repertoire-Erweiterung für das Horn hinaus bereits nach einmaligem Hören ein Werk mit charismatischen Sequenzen.
Zum Höhepunkt des Konzerts avanciert Sibelius’ (1865-1957) dritte und letzte Version seiner „5. Sinfonie Es-Dur (1919). Wie Salonen dieses Werk dirigiert, fasziniert. Die Sinfonie wird regelrecht zum spannenden Filmsound, der durch tänzerisch folkloristische Leichtigkeit beschwingt, Natur impressionistisch irrlichtern lässt, sich infernalisch verdichtet und sich final ins Triumphale erhebt.
Lange arbeitete Sibelius an diesem Werk. Ein Schwanenschwarm über seinem Haus inspirierte ihn schließlich das Werk zu Ende zu schreiben, das sich zwischen Krise und Hochgefühl bewegt, strukturell traditionell angelegt ist, aber tonal sehr modern wirkt. Ein Hornruf beschwört ausgedehnte Naturidylle, die unvermittelt in einen volkstümlichen Tanz umschlägt, womit Sibelius die gewohnte Strukturen durchbricht. Seine Motive ergeben sich organisch. Im Mittelteil, dem Andante, arrangiert er sie dann wieder klassizistisch ausgewogen, wobei das lichtdurchwirkte, weltentfremdete Spiel plötzlich lakonisch abbricht. Die berühmte bildgewaltige „Schwanenhymne“ leitet das fulminant orchestrale Finale ein, in dem Sibelius über eine Es-Dur-Kadenz im Fortissimo auf ein triumphales Ende zielt, das er durch taktelange Generalpausen gleichzeitig in Frage stellt. Rauschender Applaus!
Salonen dankte mit einer Zugabe aus Ravels „La jardin de féerique“, die einmal mehr den Unterschied zwischen intellektueller und emotionaler Musik verdeutlichte.