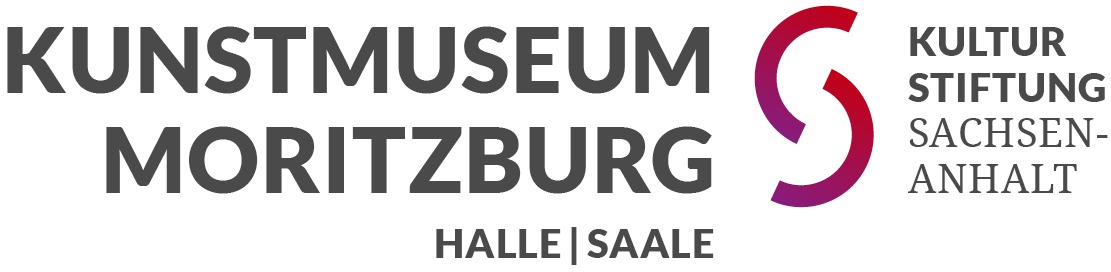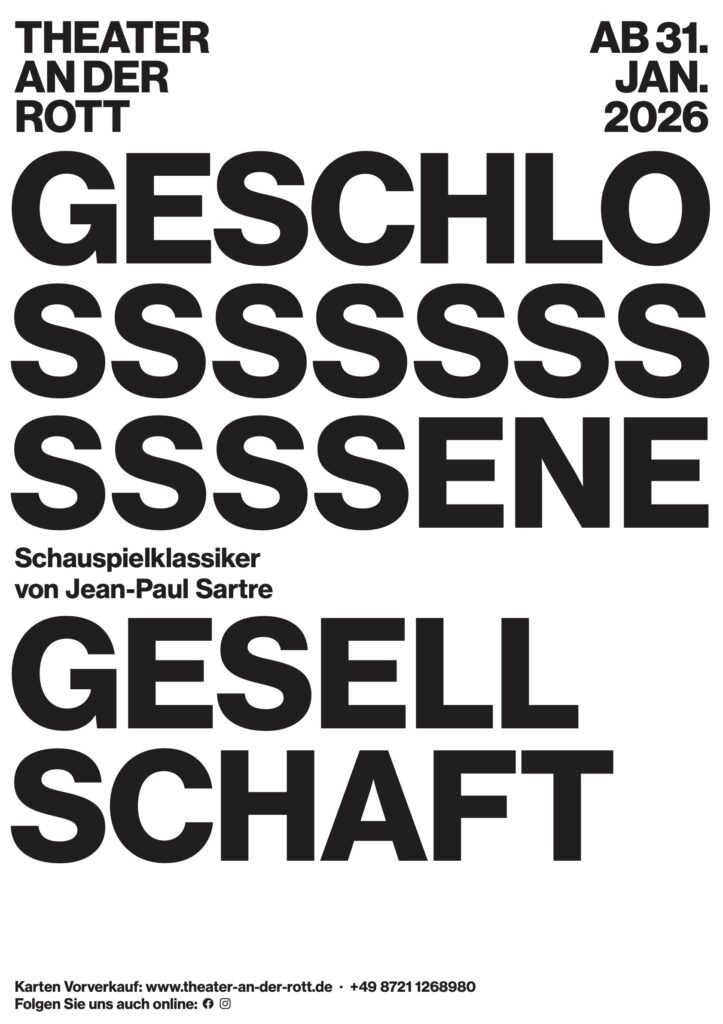©Michaela Schabel
Mehr Ausdruck durch plakative Vereinfachung, nach diesem Prinzip entwickelte Julian Gilbert Opie in den 1980er und 1990er Jahren eine sehr einfache künstlerische Handschrift, durch die…
er sehr berühmt wurde. Mit Wandobjekten, geometrisch geformten, farbig angemalten Figuren aus Stahlblech, machte er schnell auf sich aufmerksam. 1997 reduzierte er mit Hilfe eines Computerprogramms die Gesichtszüge auf schwarze Konturlinien, ohne dass dabei die individuelle Physiognomie verlorenging. Sein populärstes Beispiel ist das „Best of Blur“-Cover der britischen Band Blur. Diese reduzierten Personendarstellungen animierte er durch Computer auf Flachbildschirmen und Displays als permanente Bewegungsschleifen, in denen die Figuren vorankommen. Kombiniert mit völliger Raumlosigkeit ergibt sich eine skurrile, sehr leichtverständliche Symbolik menschlichen Gehetztseins.
Jetzt präsentiert Opie zum ersten Mal eine Auftragsarbeit für die König Galerie in Berlin. Mit seiner Installation verwandelt er die ehemalige Kirche St. Agnes inklusive Ausstellungsraum und Außenanlagen in eine moderne Stadtlandschaft mit Kirche und Hochhäusern, dazwischen bewegungsanimierte Kinderfiguren aus Lichtröhren. Sie scheinen auf der Suche nach der Spiritualität zu sein, die längst verloren gegangen ist. Das gilt auch für alle anderen Figuren. Die Porträts im Ausstellungsraum degenerieren zu Piktogrammen. Im Vorraum der Galerie wirkt eine überdimensionierte Kopffigur wie eine Betonsperre. Stahlfiguren im Garten drücken trotz ihrer kommunikativen Anordnung in Kreisform kühle Distanz aus. Das gilt auch für zwei überdimensionierte Figuren in Blau und Rot im öffentlichen Raum vor der Galerie. In Schrittstellung weit voneinander getrennt laufen sie aneinander vorbei. Opies Oberflächen-Kunst parodiert das Leben an der Oberfläche. Das ist zutreffend, aber im Grunde sehr banal.
Julian Opie, 1958 in London geboren, erlangte mit seinen farbigen Stahlobjekten bei der documenta 8 im Jahr 1994 erste internationale Anerkennung. Zahlreiche Ausstellungen in renommierten Galerien und Museen folgten, darunter die Biennale Venedig (1993), das Lenbachhaus München (1999), die Tate Britain (London), die K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf (2003), die „animals, cars and people“ veranstaltet vom Public Art Fund im City Hall Park in New York City (2004-2005).
Die Installation ist in der König Galerie, Alexandrinenestraße 118 – 121 noch bis 24. August zu sehen.