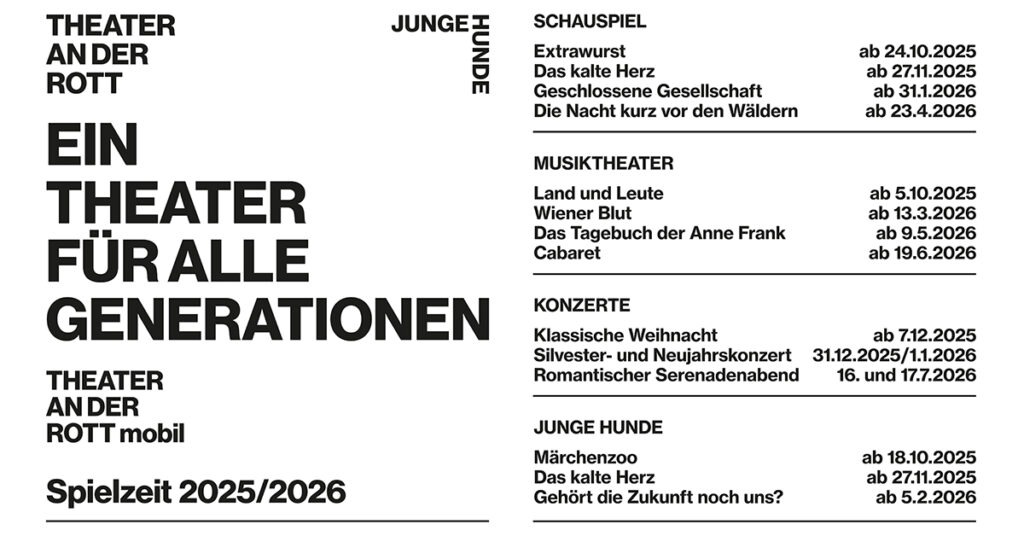Durchaus, aber Barrie Kosbys Inszenierung von Debussys einziger Oper „Pelléas et Mélisande“ zum 70. Jubiläumsjahr der Komischen Oper Berlin ist mehr, ein Meisterwerk symbolistischer Reduktion.
Er minimalisiert die Bühne, um allein die Sänger in den Mittelpunkt zu stellen. Drei ineinander geschachtelte Kuben verkleinern die Bühne zum intimen Kammerspiel. Wie Planeten im Kosmos ziehen auf den gegenläufigen Spuren der Drehbühne die Figuren aneinander vorbei. Sie können ihre Position nicht verlassen. Das Schicksal schiebt sie hin und her.

©Monika Rittershaus
Extreme Schatteneffekte, nuancierte Lichtstimmungen, eine 1a-Besetzung aus eigenem Haus entdecken Debussys Oper als das, was sie ist, ein Verdichtung urmenschlicher Bedürfnisse inklusive der Unfähigkeit zu realisieren, eine Metapher für den Alptraum des Lebens zwischen durchsonnten Momenten und tiefen Abgründen. Das alles wirkt bedrückend lebensnah, obwohl der Text nach Maurice Maeterlinks Hauptwerk des Symbolismus nur sprunghaft traumatisch erzählt ohne zu erklären.
Golaud, Enkel des Königs Arkel, verirrt sich im Wald, findet völlig verängstigt die schöne Mélisande. Er nimmt sie mit auf das Schloss und heiratet sie. Sie wird schwanger. Als sie sich in seinen Bruder Pelléas verliebt, setzt Golaud seinen Sohn aus erster Ehe als Spion ein. Aus Eifersucht und verletzter männlicher Eitelkeit erwürgt er Pelléas. Mélisande stirbt bei der Geburt des Kindes.

©Monika Rittershaus
Mit Nadja Mchantaf ist Mélisande eine Frau von heute. „Fass mich nicht an“ ist ihr erster Satz. Sofort denkt man an #MeToo. Im selben Moment fasst sie selbst Golaud an, ein bedrückender, durch die Schatteneffekte ein fast hitchkockmäßiger Gruselmoment, symptomatisch für die Beziehungen dieser Figuren. Sie fassen sich an, ohne sich zu berühren. Erst in Pelléas findet Mélisande einen Seelenverwandten. Sie verwandelt sich in eine glitzernde Goldmarie verschluckt trunken vor Glück den Ehering, um sich deren Fesseln zu befreien. Das ist der Beginn vom Ende, auch wenn Sohn auf den Schultern des Vaters mit Blick in Mélisandes Schlafzimmer dessen eifersüchtigen Visionen nicht bestätigen kann. Golaud wird zum rasenden Macho ohne jegliche Empathie für Frau und Sohn, der zum verstörten Opfer eines Rosenkrieges mutiert.
Das sind Szenen, die uns betreffen. Das ist Musik, die unter die Haut geht, weil Debussy impressionistisch filigrane Musik unter dem Dirigat von Jordan de Souza in subtilsten Tonstrukturen und verschattenden Dissonanzen das hörbar macht, in welchen Diskrepanzen die Figuren leben. Kein Glücksmoment ohne unterschwelliges Unheil. Nicht Paukenschläge, sondern die Pausen heben Chaos und Ohnmacht der Menschen hervor. Golauds Bitte um Vergebung verhallt im Schweigen. Lautlos stirbt Mélisande. Stille ersetzt den Schlussakkord.
Statt durch Arien kristallisiert der Dialoggesang alle Abstufungen menschlicher Gefühle heraus. Einfühlsam und authentisch enthüllt Nadja Mchantaf flexibler Sopran neue Facetten dieser Mélisande von strahlender Mädchenhaftigkeit über weibliche Verführung bis zum geschundenen Opfer. Resolut, dominant, kehrt Günter Papendells voller Bariton immer mehr die dunklen, panischen Seiten Golauds heraus. Jens Larsen mächtiger Bass lässt König Arkels Ambivalenz zwischen letzten Erotiksehnsüchten und dem Dilemma männlicher Vergreisung anklingen. Pélleas fällt aus diesen Macho-Mustern. Ihm gibt Dominik Köningers warmer Bariton trotz kafkaesk linkischer Optik, verquerer Haltung unter der Dominanz seines Halbbruders Golaud die Größe aufrichtiger Liebe.
Und nur eine Stimme strahlt unschuldig über allen, die des Sohnes alias David Wittichs, Solist des Tölzer Knabenchores. In seinen Ängsten kündigt sich die Wiederholung der Tragik auf einer neuen Planetenlaufbahn an.
Michaela Schabel
Kommentare an michaela.schabel@freenet.de