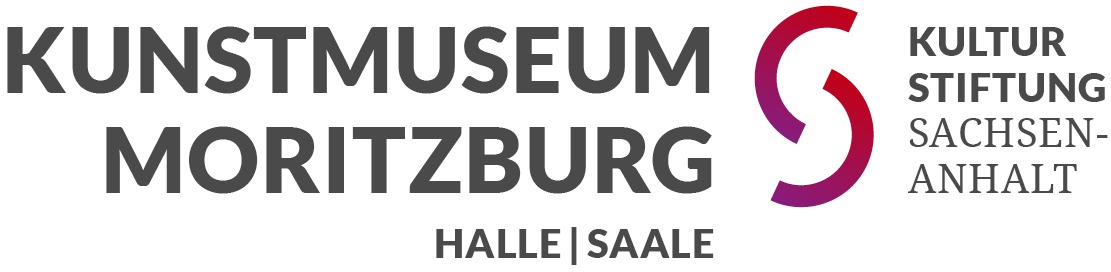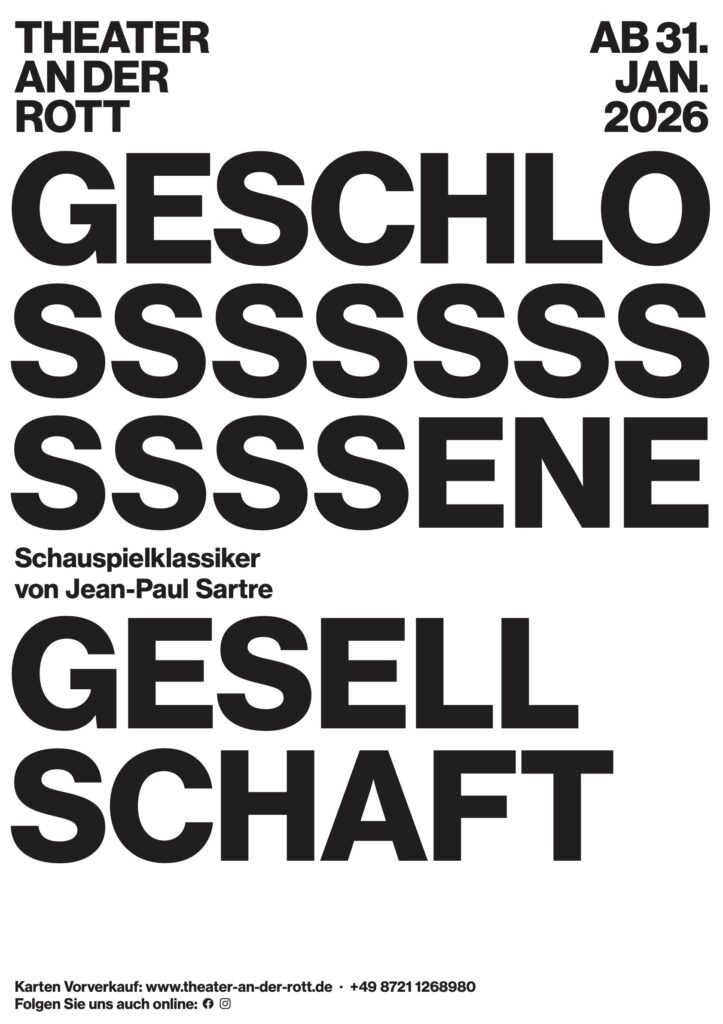©Oper Chemnitz, Foto: Nasser Hasnemi
Wuchtig, hektisch tönen die Schlagwerke. Die Streicher fetzen dissonant. Die Bühne, in Staubnebel eingehüllt, macht sofort klar,…
wie hart die Arbeit in der einstigen Wismutförderung in der DDR gewesen sein musste. Doch die „schwerste Arbeit ist es, immer wieder zu hoffen“. In beeindruckenden, bildgewaltigen Sequenzen bringt Regisseur Frank Hilbrich die Uraufführung der „Wismut-Oper“ nach Bräunigs Roman „Rummelplatz“auf die Bühne.
Der „Rummelplatz“, der einzige Ort, wo die Arbeiter abschalten konnten, wird zur Metapher illusionärer Hoffnungen. Lichterketten im Nebel skizzieren ihn als realen Ort. Projektionen, in denen Arbeiter im Überschlagschaukel nach oben und unten sausen, lassen Momente der Schwerelosigkeit und das Loslassen des bedrückenden Alltags miterleben. Der Alkohol ist die andere Variante der Befreiung. Kleinigkeiten führen zu Schlägereien, wobei die Miliz rigoros einschreitet, selbst bei Tanzveranstaltungen. Wer nicht spurt, wird niedergeknüppelt, verhaftet, verurteilt. Zeugenaussagen für den Angeklagten werden ignoriert.
Anlässlich der Feierlichkeiten als Weltkulturerbe beauftragte die Oper Chemnitz Komponist Ludger Vollmer und Librettistin Jenny Erpenbeck Bräunigs 600-seitiges DDR-Arbeiterepos umzusetzen. Es ist ein wichtiger Beitrag zum Motto „C the Unseen“.
Bräunig beschreibt das Potenzial des neu entstandenen sozialistischen Staats zwischen 1949 und 1953, bezieht auch die Vorgeschichte mit ein, „Der Krieg hat sogar die Jungen alt gemacht“ und kritisiert, wie wenig der jungen Generation vertraut wurde, wie die Funktionäre durch ihre Engstirnigkeit und ihr Misstrauen Angst und Aggressionen in der Arbeiterklasse verbreiteten, wodurch die Gesellschaft von innen zu bröckeln begann. Die Opernversion weitet die Thematik und bezieht die Ereignisse von der Auflösung der DDR 1989 bis zur Zechenschließung 1990 mit ein. Plötzlich ging der Lebenssinn für viele Menschen verloren. Sie wurden mit einer neuen Eigenverantwortlichkeit konfrontiert.
Hilbrich fokussiert auf den Spannungsbogen zwischen Hoffen und Scheitern, den das klug reduzierte Libretto und die extrem emotionale Komposition vorgeben. Exemplarisch leuchten in der Masse unterschiedliche Protagonisten auf, die voller Empathie und Respekt gezeichnet werden. Sie bewegen sich immer wieder in Zeitlupe, womit Hilbrich einen Gegenpol zur wuchtigen Dynamik der Musik schafft. Dieser optisch-akustische Kontrast gibt dem Publikum Raum zum Nachdenken über die kontroversen Einstellungen. „Wir machen Erz. Das Erz im Gegenzug macht uns. Wenn wir nur hartnäckig genug sind. Wenn nicht, verheizt es uns“, so Christian.
Unter der musikalischen Leitung von Benjamin Reiners kommt die Melodik und die motivsymbolische Emotionalität der Komposition bestens zur Wirkung. Triolische Figuren als rhythmische Akzente in immer schnelleren Tempi machen wachsendes Gewaltpotential hörbar. Im Auf und Ab von ratternden Ganztonleitern kommt das maschinelle Funktionieren der Menschen bis zum lebensbedrohlichen Exit zum Ausdruck. Scheinchromatische Dissonanzen, komplizierte Rhythmen steigern Tanz- und Gewaltszenen ins unberechenbar Rauschhafte. Umso intensiver wirken die poetisch melodischen Momente dazwischen, wenn menschliche Zuwendung aufleuchtet. Wie aus einer anderen Welt stimmt der Chor die Vertonung von Heinrich Heines berühmten Loreley-Gedicht an „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“, wobei sich die Verunsicherung der Menschen spiegelt.
Durch Volker Thieles Bühnenbild gewinnt die Inszenierung einen mitreißenden Realismus. Er leuchtet hinab in die Wismutstollen, wo die Arbeiter ganz allein auf Knien ohne Schutzbekleidung Uran abbauten. Manche Figuren überdimensioniert und bunt schrill konzipiert lassen effektvoll Autoritäten und unerfüllte Sehnsüchte aufeinanderprallen. Jede Szene überrascht.
Ausgezeichnet sind die sängerischen Leistungen einschließlich des Chors, der wie in der Antike das Geschehen kommentiert. „Mehr arbeiten für weniger Lohn? Ist das der Arbeiterstaat? Wir wollen leben.“ Voller Wucht und Trotz agiert Thomas Essl als Peter Loose, der sich in die zarte Ingrid (Marlen Bieber) verliebt. Jaco Venter setzt als Obersteiger Hermann Fischer sängerisch Akzente, Maraike Schröter als eines der drei grellen Mädchen. Dem intellektuellen Kumpel Christian Kleinschmid, der lieber studieren möchte, gibt Etienne Walch durch seinen fulminanten Countertenor intellektuelle Gelassenheit, die sich später trotz seiner Karriere als Professor in den USA in elegische Tristesse wandelt, weil Ruth, sehr temperamentvoll und leidenschaftlich von Menna Cazel interpretiert, nicht mit ihm fortgegangen ist und sich im Wismutwerk lebensbedrohlich krank gearbeitet hat. „Ich hab die Arbeit gemacht. Und die Arbeit hat mich gemacht. Es war mein Leben. Auch wenn es jetzt so aussehen mag, als wär das alles nichts wert.“ Ihre Perspektive verweist auf die Problematik der Wiedervereinigung, die viele Menschen im Osten immer noch bewegt.
Zwei Menschen lieben sich und entfernen sich als zwei Einsame. Damit schlägt der „Rummelplatz“ ganz nebenbei auch noch eine Brücke zur derzeitigen Munch-Ausstellung „Angst“ in den Kunstsammlungen Chemnitz nebenan.
Künstlerisches Team: Ludger Vollmer (Komposition), Jenny Erpenbeck (Libretto), Benjamin Reiners (Musikalische Leitung), Frank Hilbrich (Inszenierung), Volker Thiele (Bühne), Gabriele Rupprecht (Kostüme), Stefan Bischoff (Video), Stefan Bilz (Chor)