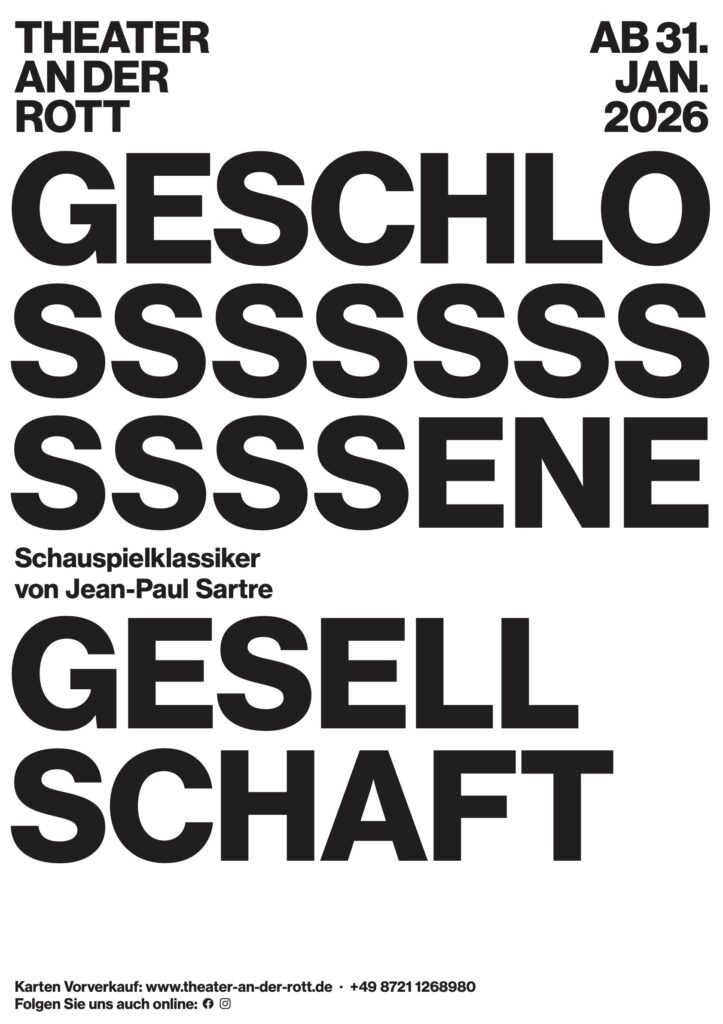©Neue Visionen Filmverleih
Plakate mit „Jahrhundertfilm“ und Statements „Um diese 160 Minuten beneidet uns die ganze Welt“ lassen die Erwartungen an Mascha Schilinskis „In die Sonne schauen“ steigen. In der Tat ist es…
ein außergewöhnlicher Film, der entgegen bisheriger Erzählformen mutig 100 Jahre Zeitgeschichte rein assoziativ enthüllt und Film neu denken will.
Inspiriert von einem Aufenthalt auf einem altmärkischen Bauernhof und alten Fotografien hinterfragt Mascha Schilinski zusammen mit ihrer Co-Autorin Louise Peter menschliche Beziehungen in schweren Zeiten des Krieges und der Nachkriegsjahre im Zonenrandgebiet.
Wie in einem Puzzle offenbart sich zwischen distanziert voyeuristischem Alltagsrealismus und magisch poetischen Momenten aus der Perspektive von vier Mädchen menschliches Rollenverhalten in verschiedenen Zeitebenen, wobei die Sicht der siebenjährigen Alma immer mehr an Bedeutung gewinnt. Durch ihre neugierigen Blicke durch Schlüssellöcher und ihre unerschrockene Art erleben die Kinobesucher, wie sich die Rollen der Frauen über Generationen hinweg ähneln und sie der übergriffigen Dominanz der Männer ausgesetzt sind.
Lia stürzte sich vom Heuwagen, um ihrem Schicksal als Magd auf einem fremden Hof zu entgehen, „Arbeitsunfall“ heißt es dann genauso wie beim beinamputierten Bruder, als er hinter den großen Scheunentoren verunglückt. Während der Tod des kleinen Bruders nur als Foto präsent ist. Angelika entdeckt ihre weibliche Ausstrahlung und verdreht den Männern den Kopf. Lenka, sucht ihre Identität über die Nachahmung der Freundin, die mit ihrer Familie aus Berlin zugezogen ist.
Der Tod ist das zentrale Thema des Films. Er ist der ständige Mit-Akteur und trotzdem wissen die Menschen zu feiern, zum Akkordeon zu tanzen und sich bei Wettspielen zu amüsieren. Die Mutter dagegen kann nur in höchst angespannten Situationen lachen, ganz nah herangezoomt Ausdruck irren Schreckens.
Schilinski wählt das klassische 4:3-Filmformat, vertraut ganz der Kraft der Bilder, der farblichen Intensität, die Zeitebenen markiert, oder in diffuser Ungenauigkeit Ungewissheiten und Bedrohliches atmosphärisch zur Wirkung bringt. Graue Flächen irritieren, würgen narrative Weiterentwicklungen ab, eröffnen stattdessen den Blick auf sich wiederholende Verhaltungsweisen.
Bewusst verzichtet Schilinski abgesehen von einzelnen Liedern auf einen Filmsound. Umso intensiver wirkt jedes Geräusch psychosymbolisch. Wuchtig schlägt Angelika einen herrschaftlichen Kachelofen in Trümmer. Bedrohlich nähert sich der Mähdrescher, einem Rehkitz, das sie durch Fahnenzeichen beschützt. Wenn sich sonores Brummen zu bedrohlichem Flugmotorenlärm verwandelt, wird der Krieg wieder präsent.
Einzelne Motive tauchen leitmotivisch auf. Desolate Teppiche in heruntergekommenen Wohnverhältnissen erinnern an bessere Zeiten. Die Reduktion der sozialen Kontakte auf die unmittelbare Nachbarschaft zeigt die Isolation der Menschen. Der Fluss wird zum Symbol von Freiheit und Untergang. Manche möchten im Wasser dem Leben entrinnen, tauchen doch wieder auf und ergeben sich dem Schicksal der schweren landwirtschaftlichen Arbeit. Apokalyptisch braust ein Sturm über die Erntearbeiter. Die Mutter entschwebt mit dem Kind gen Himmel. Nur der Tod erlöst.
Gerade weil Schilinski chronologische Narrative verweigert, wird der Kinobesucher zum Spurensucher. Das ist bei einer Filmlänge von 149 Minuten zuweilen anstrengend. Der Premierenapplaus im Berliner Delphi Palast fiel verhalten aus. Zu sehr war man mit Nachdenken beschäftigt.
„Ein Film für die Ewigkeit“ oder „Eine echte Sensation“, wie das Filmplakat suggeriert, ist „In die Sonne schauen“ allerdings nicht, auch wenn der Film in Cannes den Jurypreis gewann und er für die Academy Awards 2026 nominiert wurde.
Künstlerisches Team: Mascha Schilinski (Regie, Drehbuch), Louise Peter, (Drehbuch), Helena Wittmann (Kamera), Gesa Marten (Schnitt), André Bendocchi-Alves (Ton)
Mit Alma (Hanna Heckt), Lea Urzendowsky (Angelika) Lea Drinda (Erika), Luise Heyer (Christa), Laeni Geiseler (Lenka); Zoë Baier (Nelly), Susanne Wuest (Emma) und anderen