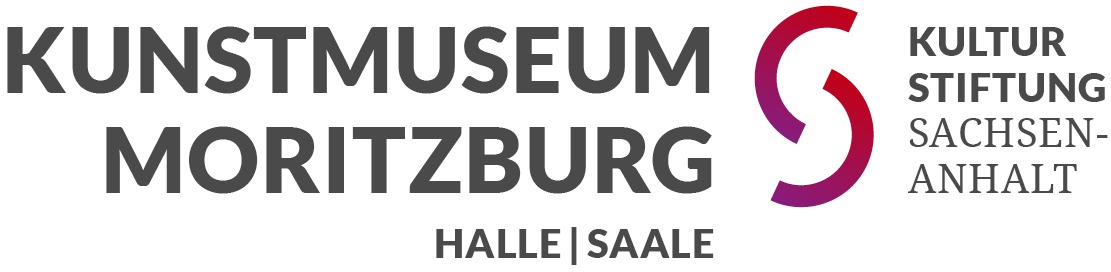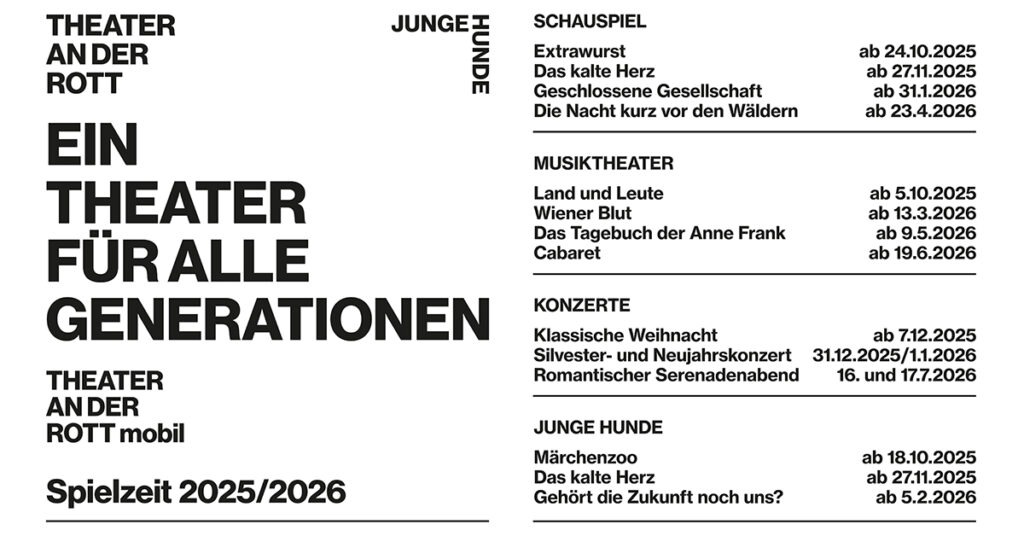„Parfüm n°2“ (Ausschnitt), Auguste Herbin, 1954@Sammlung Galerie Lahumière Paris, Foto: Michaela Schabel
In Frankreich gilt Auguste Herbin (1882-1960) als Revolutionär der Moderne und einer der Begründer der Abstraktion. Wilhelm Uhde, deutscher Galerist und Kunstkritiker, wurde 1904 auf ihn aufmerksam, und bewirkte…
durch Ausstellungen, dass Herbin auch in Deutschland gesammelt wurde und wird. Jetzt rückt ihn das Münchner Lenbachhaus ins Bewusstsein und zeigt anhand von 50 Gemälden, sehr übersichtlich und klar kuratiert, die verschiedenen Schaffensphasen des Künstlers im Zusammenhang mit seiner Biografie und den politischen Verhältnissen. Herausragendes Merkmal seiner Kunst ist, egal in welchem Stil er malte, der Umgang mit Farbe und der offeriert ganz neue Perspektiven.
Kurz nach der Jahrhundertwende begann Herbin mit Landschaften, Stillleben und Porträts in satt leuchtenden, harmonisch abgestimmten Farben, wobei die Bilder durch schwarze Konturen, kantige Formen schon expressionistische Züge zeigen und durch übergreifende Musterungen und kurze Pinselstriche impressionistisch irrlichtern.
Über eine Ausstellung des „Salon des Indépendants“ geriet Herbin in den Bannkreis der „Vauxes“, der „Wilden“, die auf eine ganz neue Weise mit Raum und Farbe umgingen. 1909 bezog er ein Atelier im berühmten Bateau-Lavoir auf dem Pariser Montmartre in unmittelbarer Nachbarschaft zu Picasso und van Dongen. Er begann kubistisch zu malen, wobei er über sein Experimentieren mit schlichten archaischen und geometrischen Formen und satten Farbgebungen eine hyperplastische, aktivierende Formensprache entwickelte und zu den Mitbegründern des Kubismus wurde. Inspiriert vom Swing und Jazz der 20er Jahre entwickelte er seine Abstraktionen auf dunklem Hintergrund durch hell leuchtende Farblinien weiter, wobei ihm synergetische Fusionen von Musik und Malerei gelangen. Betrachtet man die Bilder, spürt man auch ohne Titel die latente Rhythmik, will man sich tänzerisch bewegen.
Die Bilder gefielen Herbins Galeristen Rosenberg durchaus, waren aber schwer verkäuflich, weshalb er seine Künstler anregte, mehr Bilder zu malen, die man über die Couch hängen konnte. So erklären sich Herbins dekorative Landschschaftsbilder, die er in unterschiedlichen Gegenden Frankreichs und im belgischen Brügge malte, im Hamburger Hafen und auf Korsika. Jeder Ortswechsel brachte die Wahrnehmung neuer Formen mit sich und löste Veränderungen in seiner Bildsprache aus, die in den 1930er Jahren auf die Abstraktion zielte.
Während des Ersten Weltkriegs entwickelte Herbin für dekorative Holzobjekte ein völlig abstraktes, geometrisches Formenvokabular, das an die Archaik afrikanischer, aztekischer, tolketischer Kultur erinnert und das er als sozial engagierter Künstler und zeitweiliges Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs als „Kunst für alle“ deklarierte.
1942 spiritualisierte er seine Abstraktionen durch ein „alphabet plastique“, ein Regelwerk der reinen Farbtöne und geometrischen Formen, Musiknoten und Buchstaben, inspiriert von Goethes Farbenlehre, Rudolf Steiners anthroposophischer Denkweise und Bachs Musik. Jedem Buchstaben ordnete er eine Farbe zu, die erste Hälfte des Alphabets sind das Gelb-, Orange-Rotschattierungen, in der zweiten Grün-, Blau-, Violett- und Schwarztöne, dazwischen das „M“ als Wendemarke ein blasses Baryt-Gelb. Nach Herbins Theorie lässt sich die „Réalité Spirituelle“, die geistige Wirklichkeit, nur durch Farbe vermitteln, wobei er einfache geometrische Formen, Buchstaben und Noten durch leuchtende Farben raffiniert ausbalancierte, damit ein farbästhetisches Neuland kreierte und Farbformen in verschiedenen Variationen immer wieder emotional interpretierte.
Nach 1945 wurde Herbin Vorbild für die Vertreter der konkreten und kinetischen Kunst und der Op-Art. Er engagierte sich bis zu seinem Tod als Erneuerer der französischen Abstraktion.
Die Ausstellung „Auguste Herbin“ ist im Münchner Lenbachhaus noch bis 18. Oktober zu sehen.